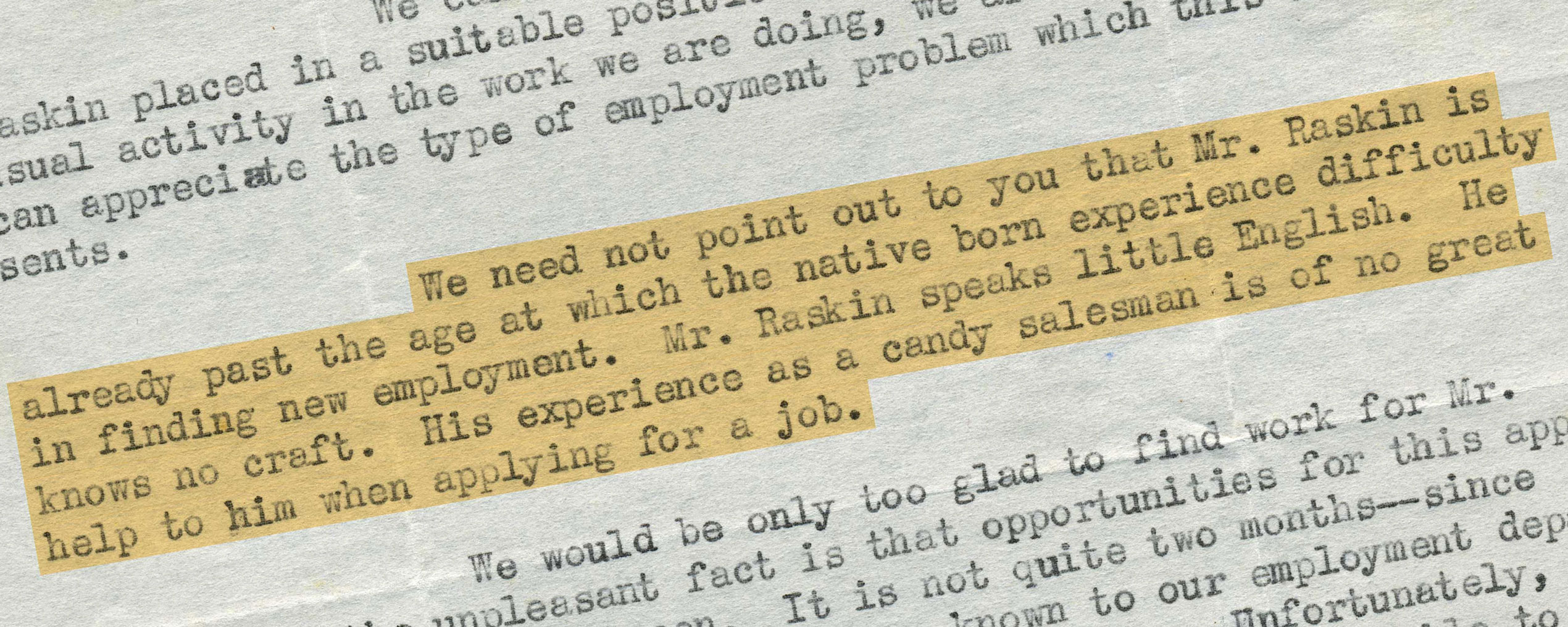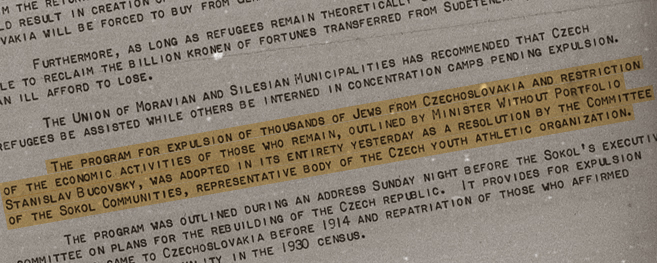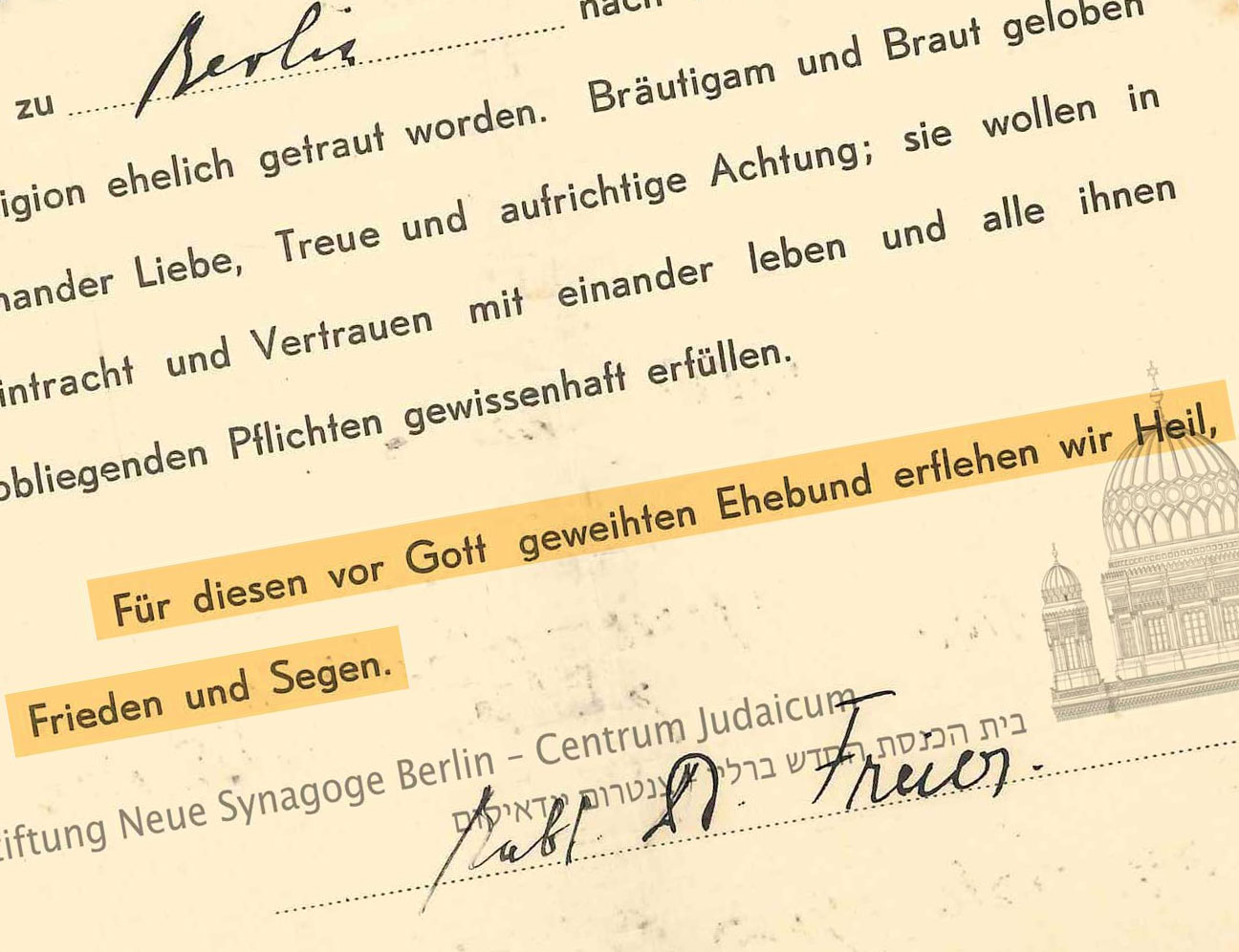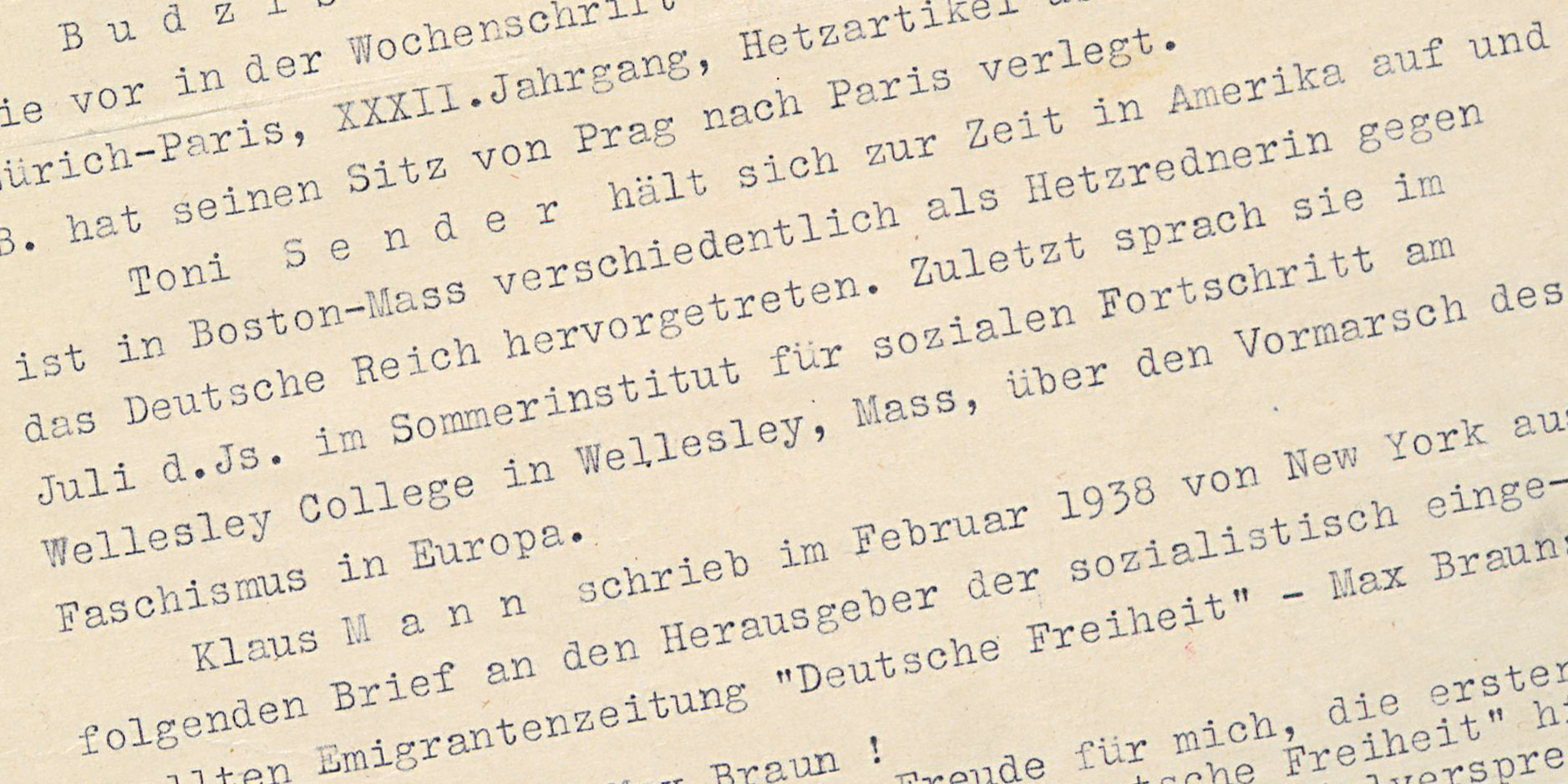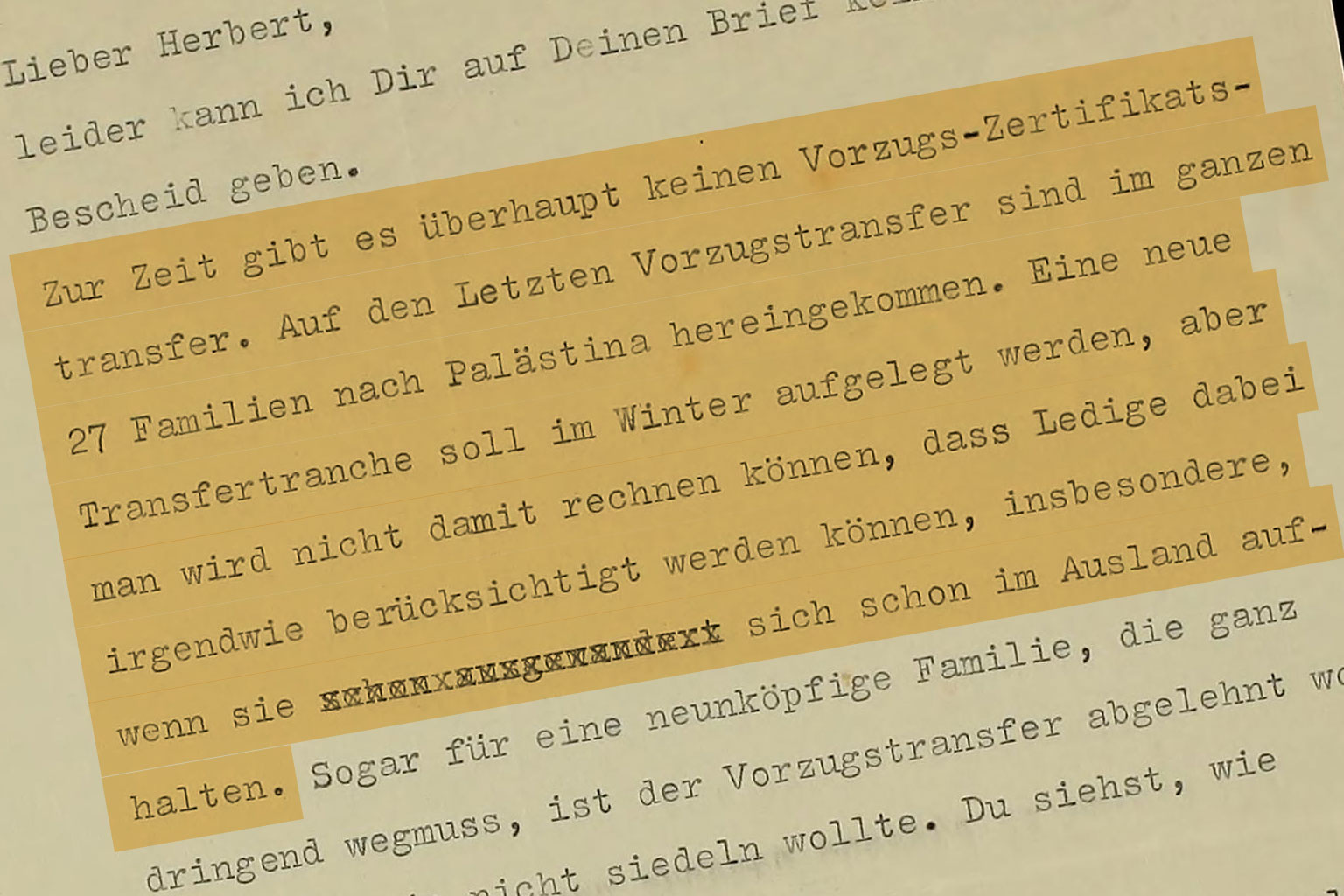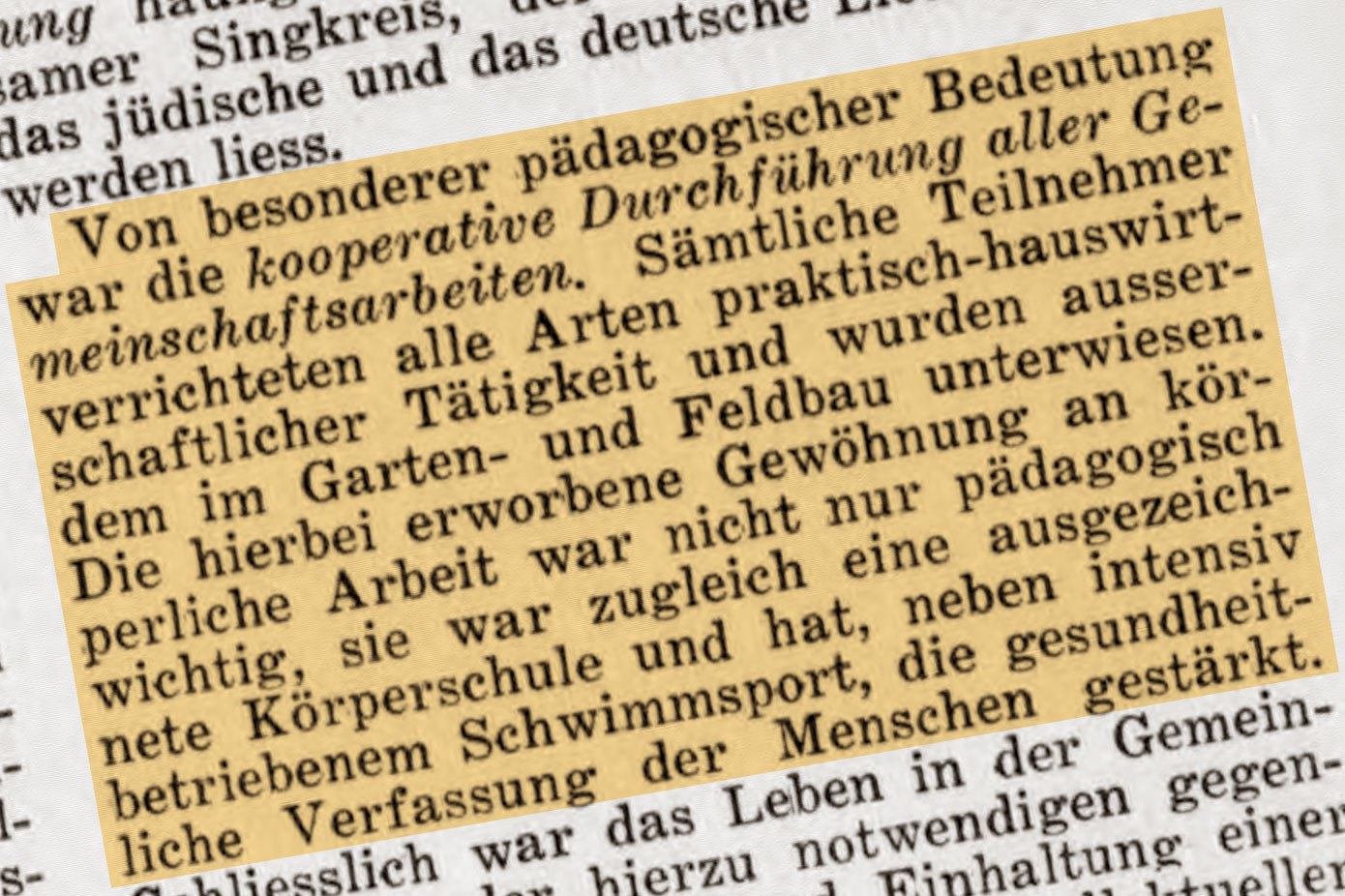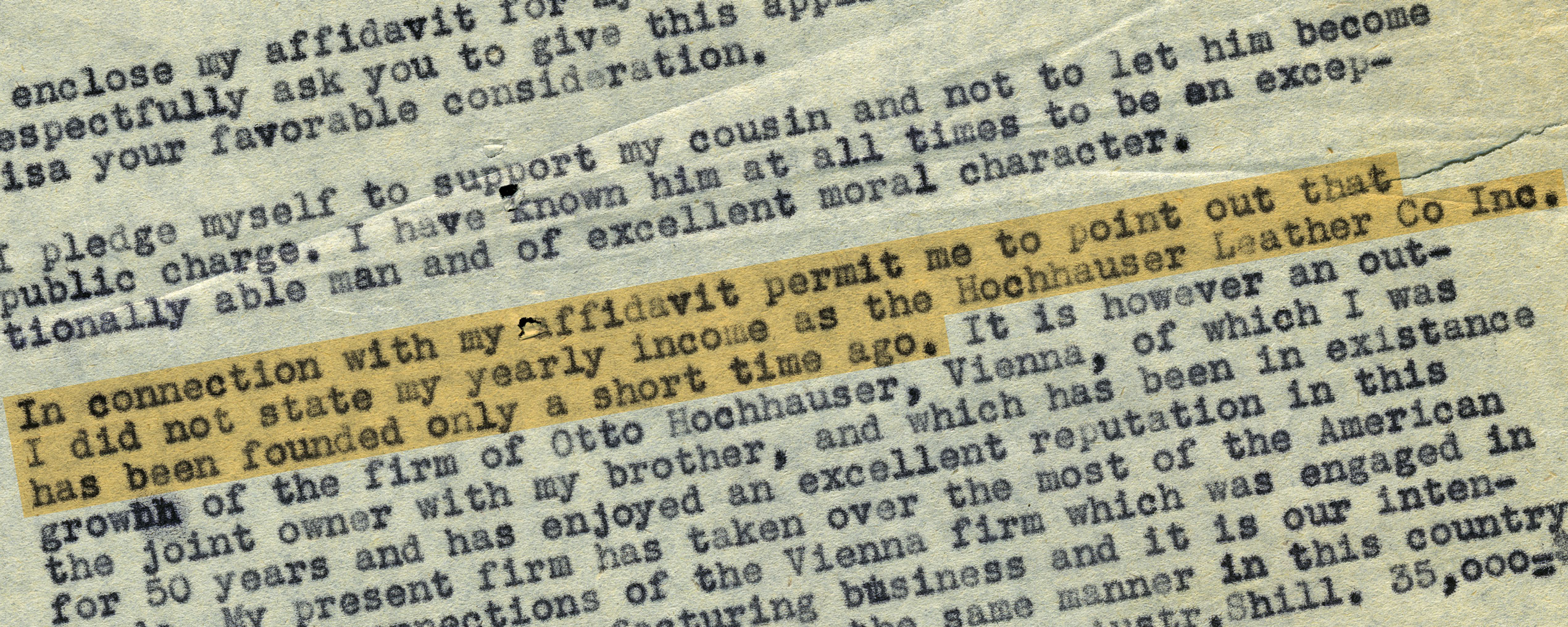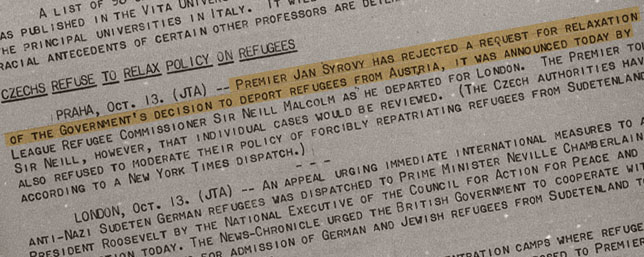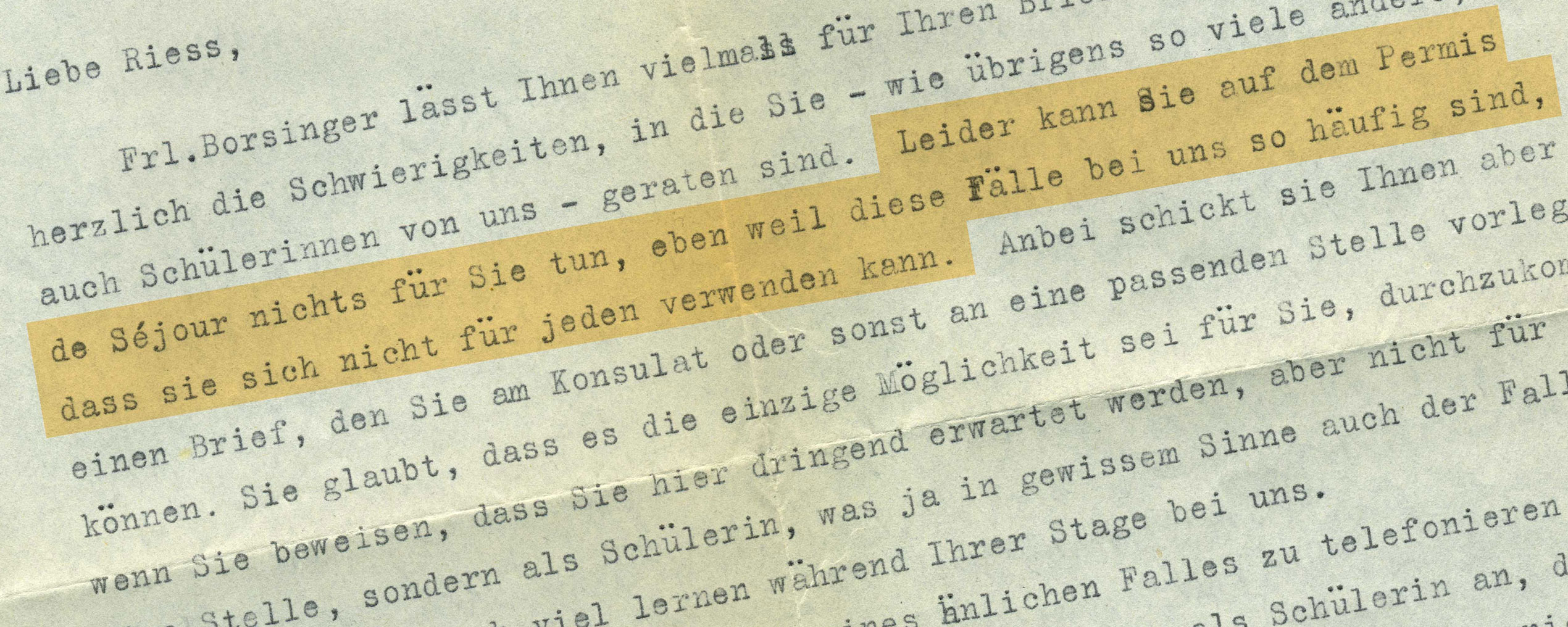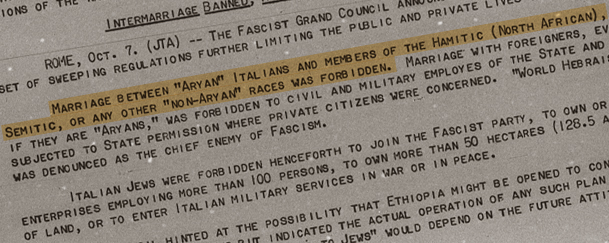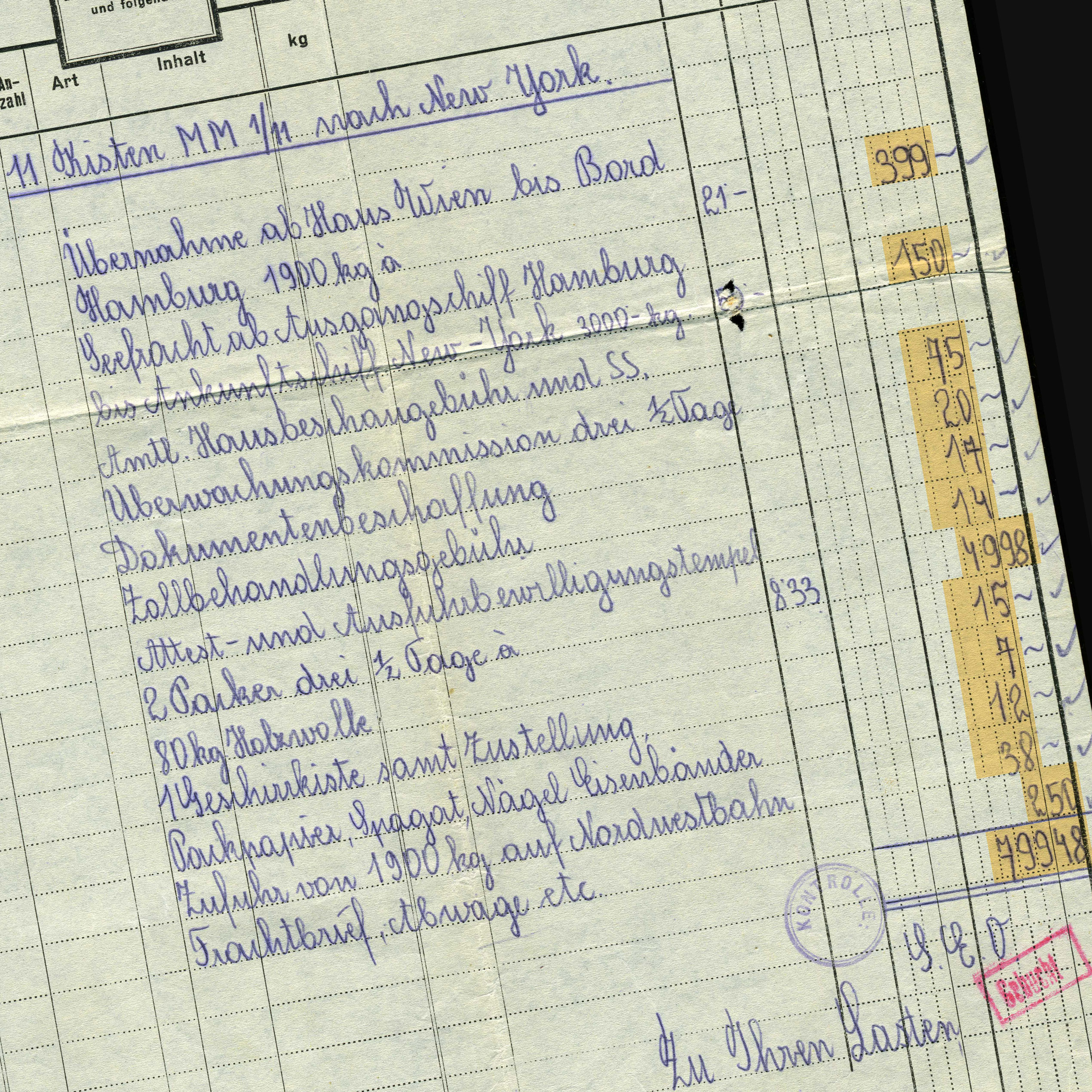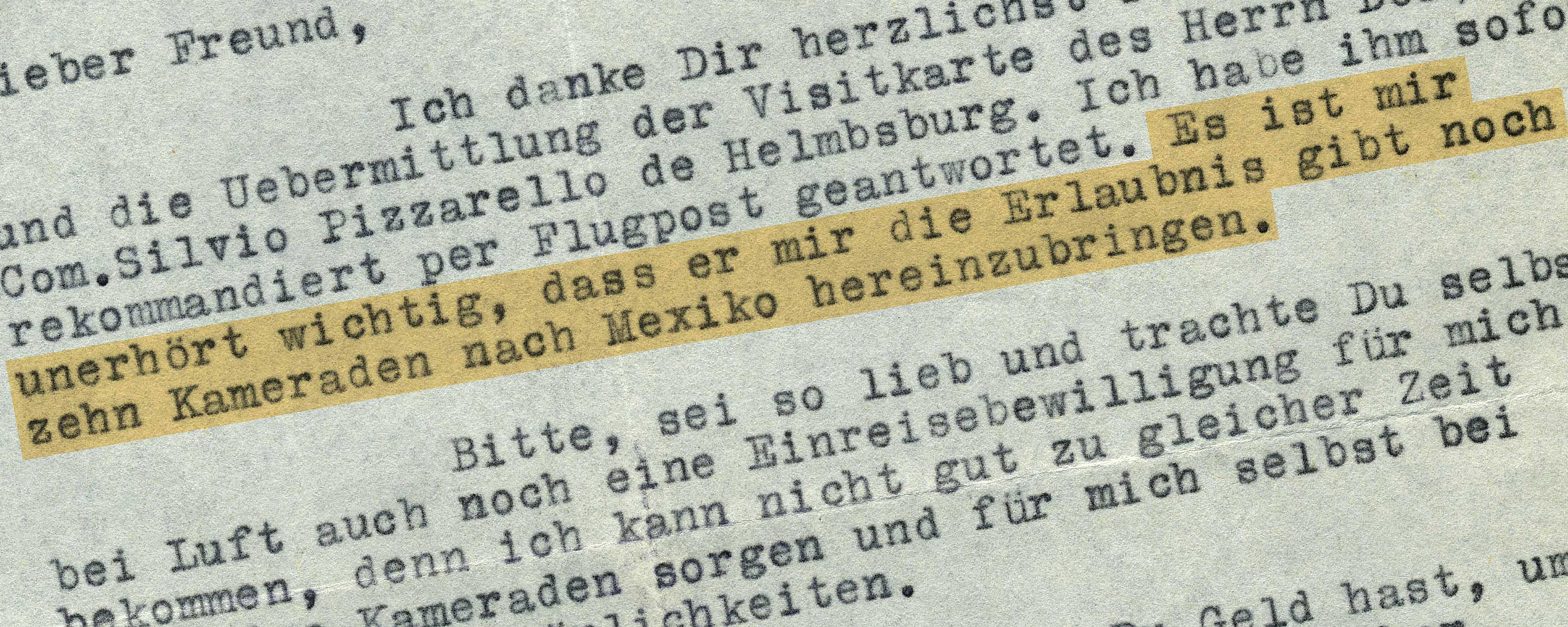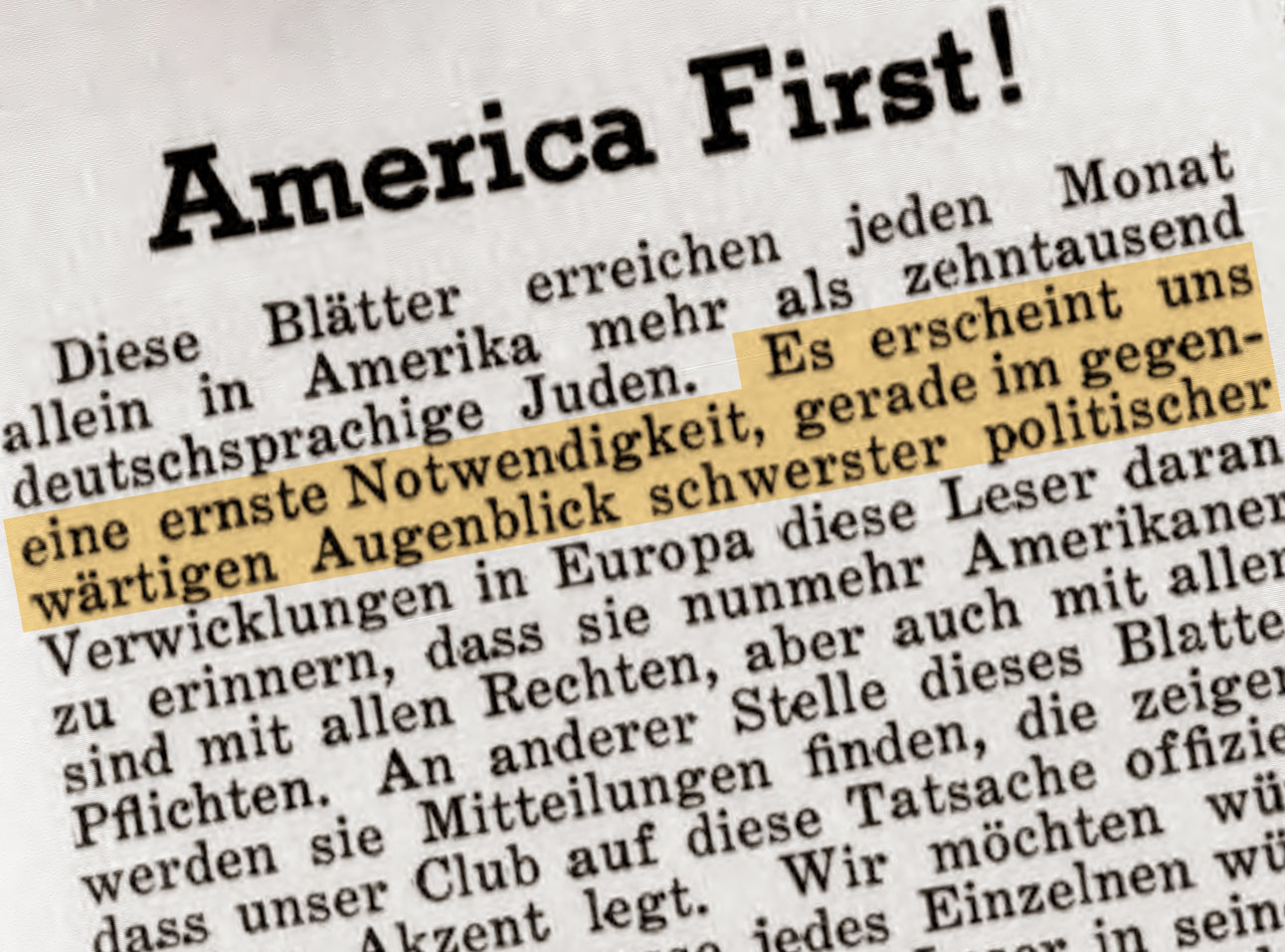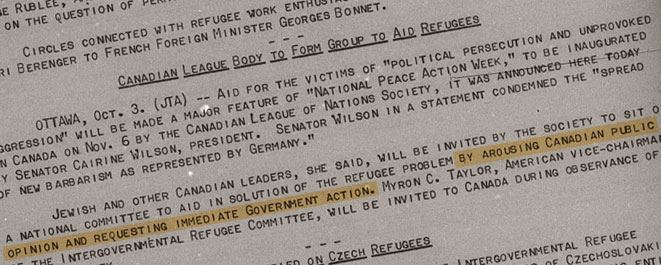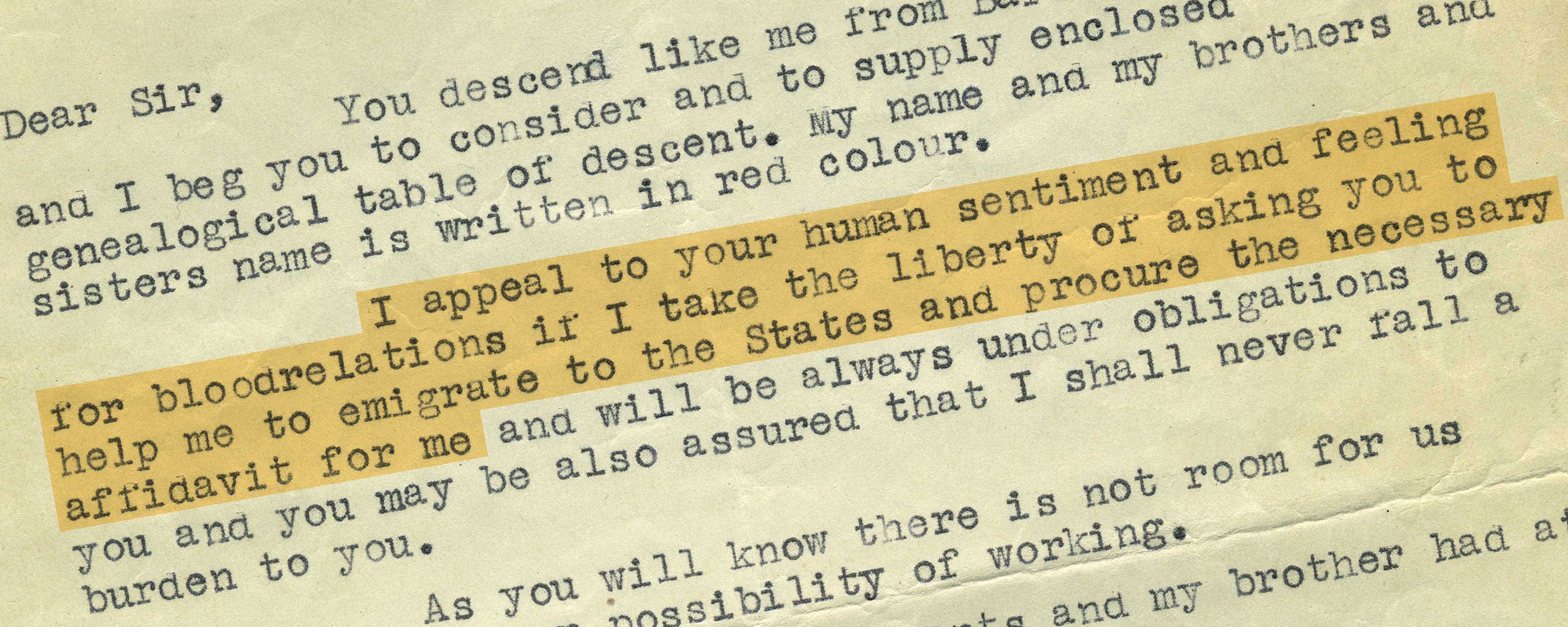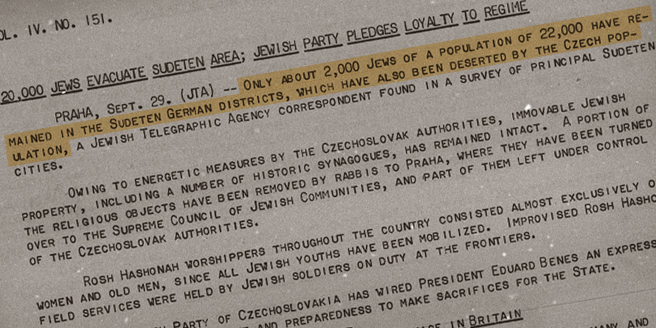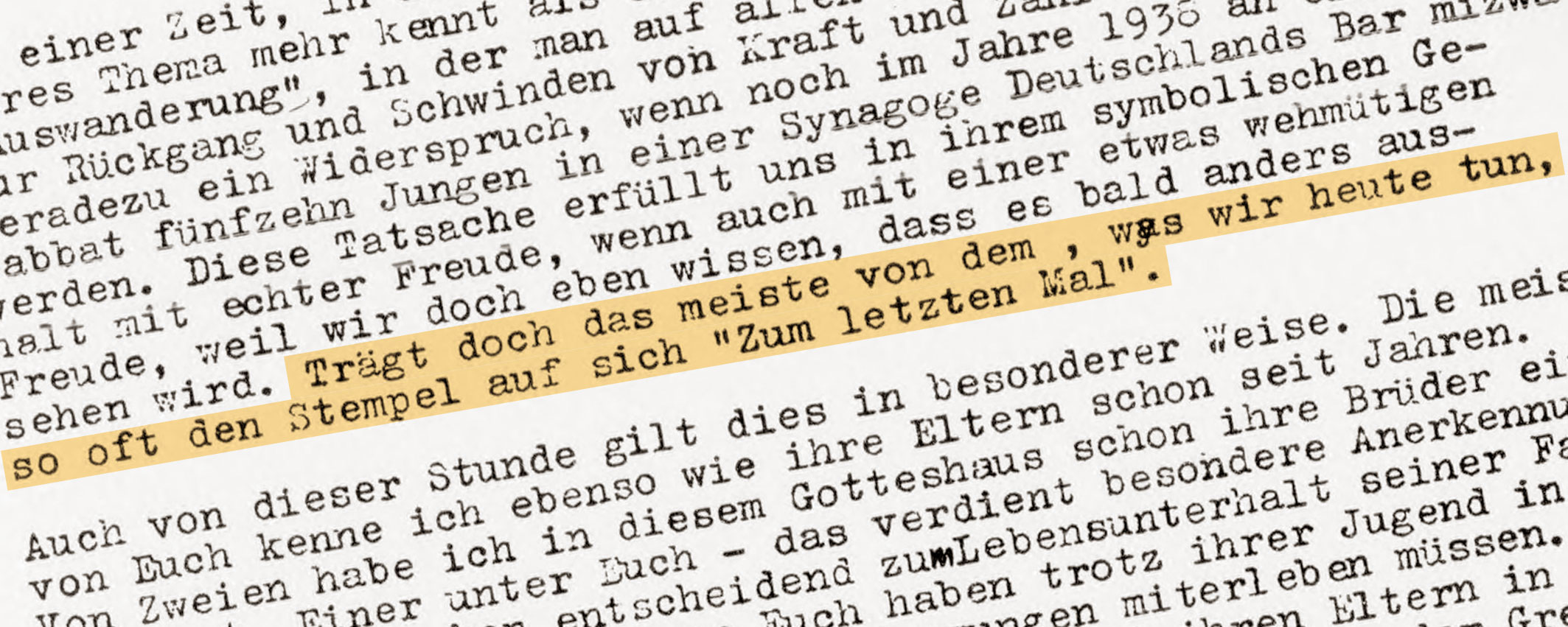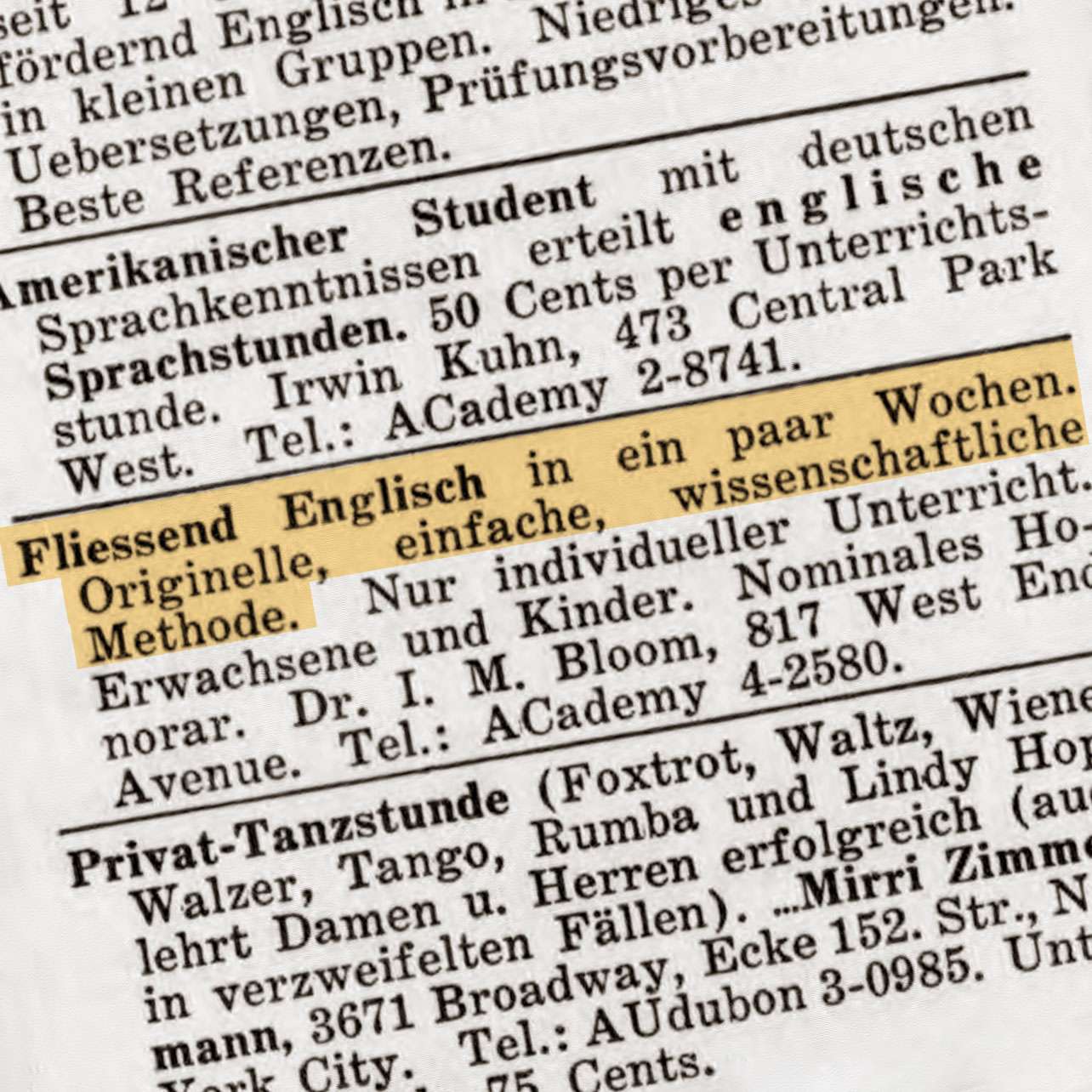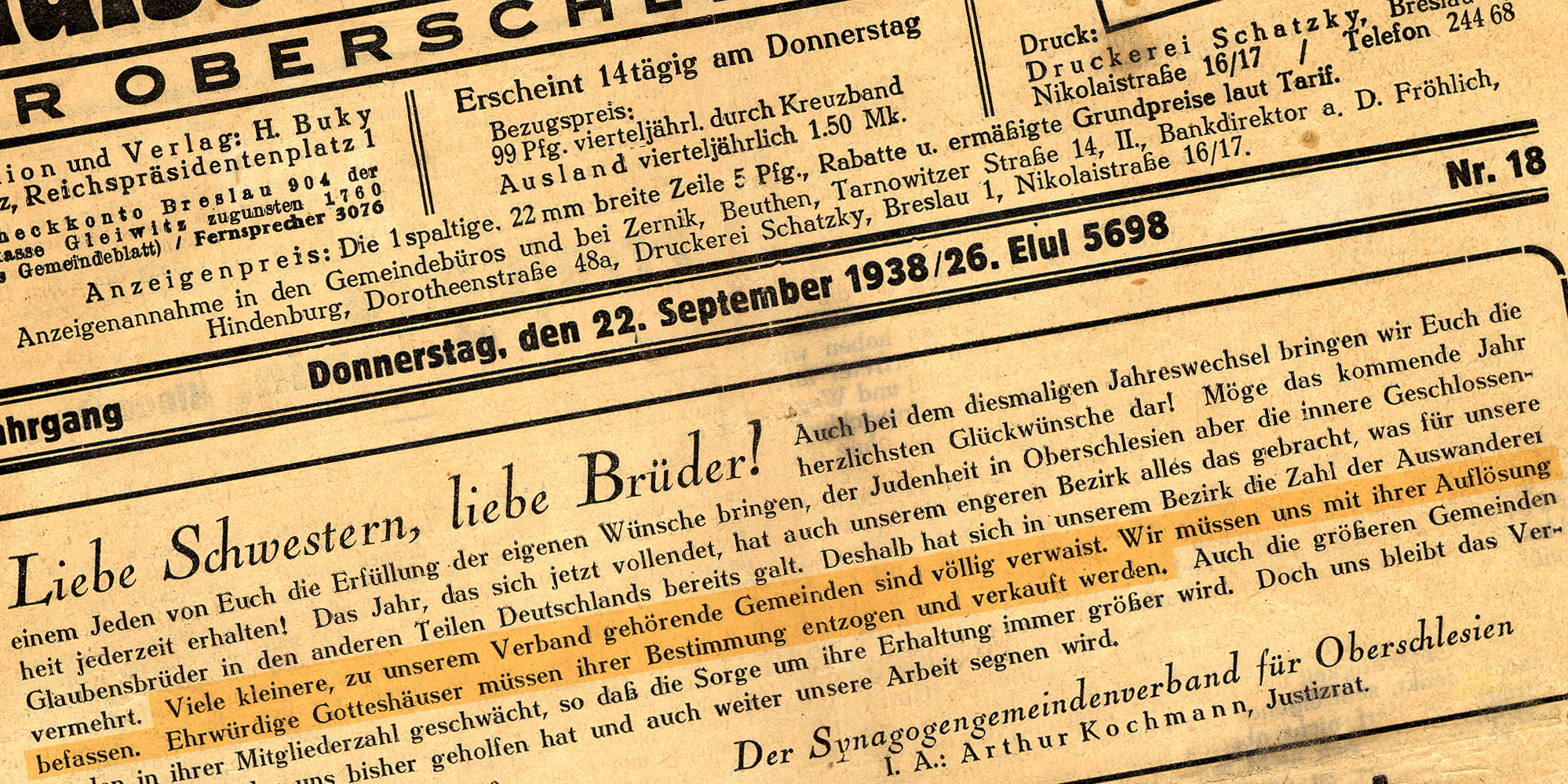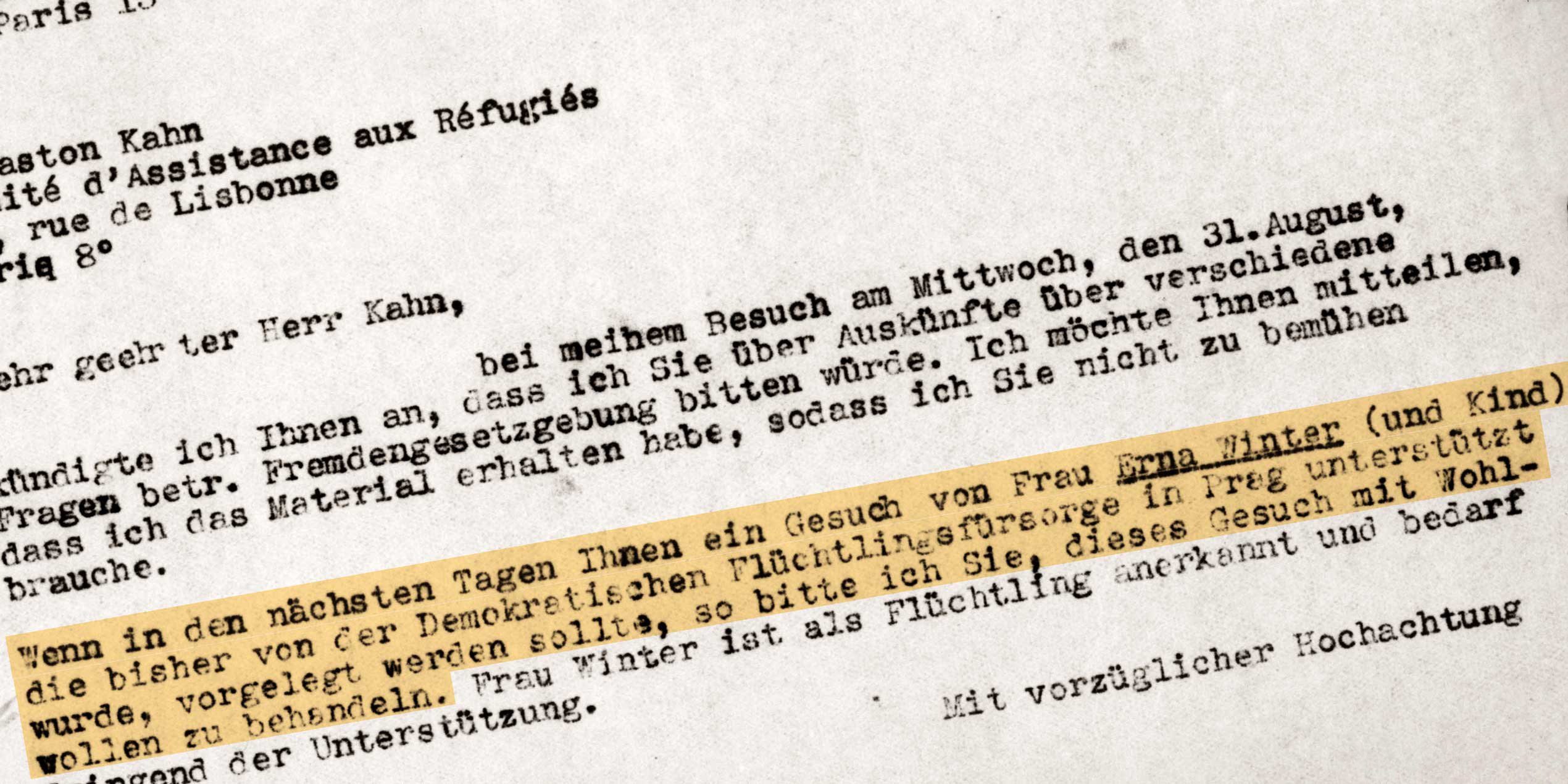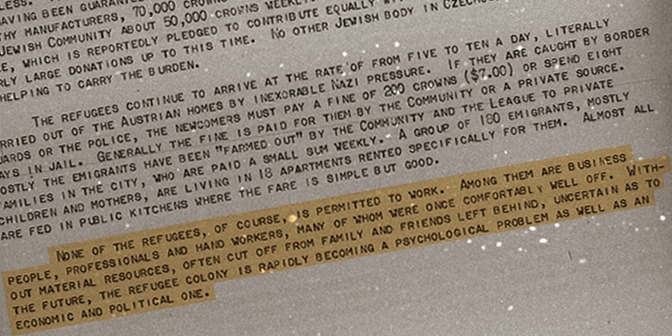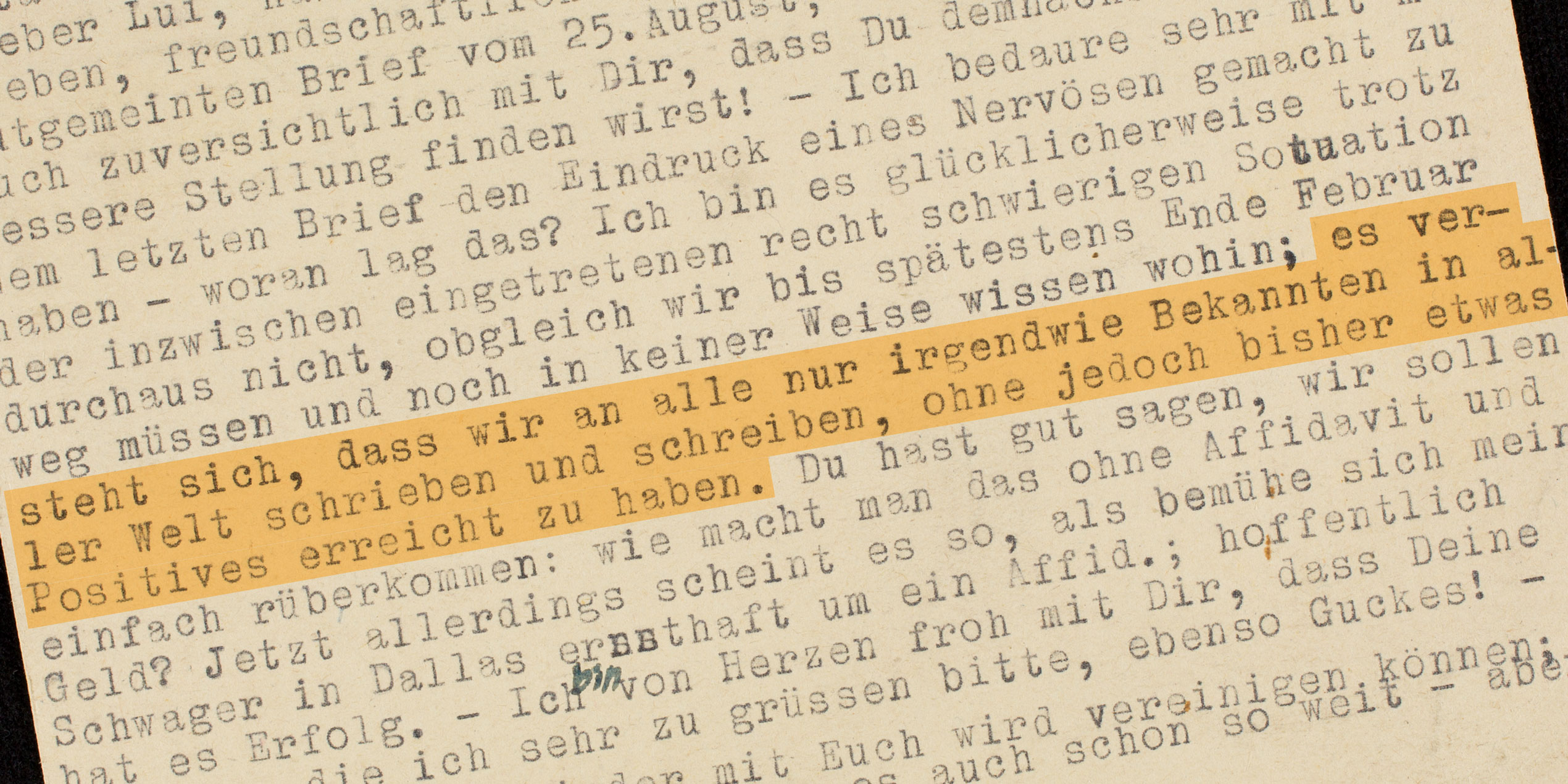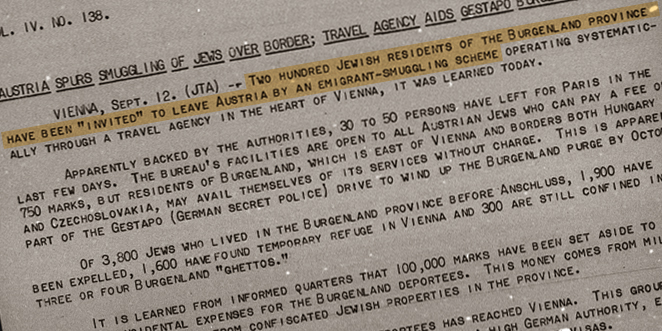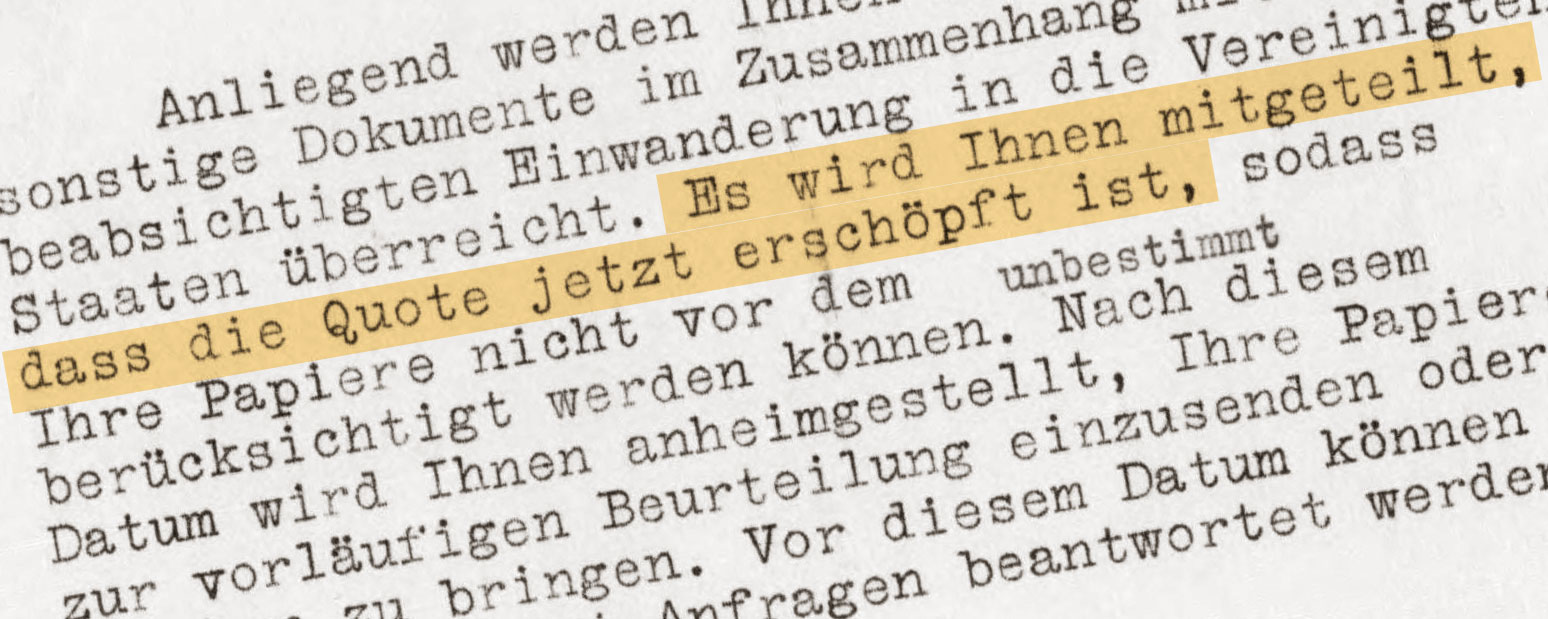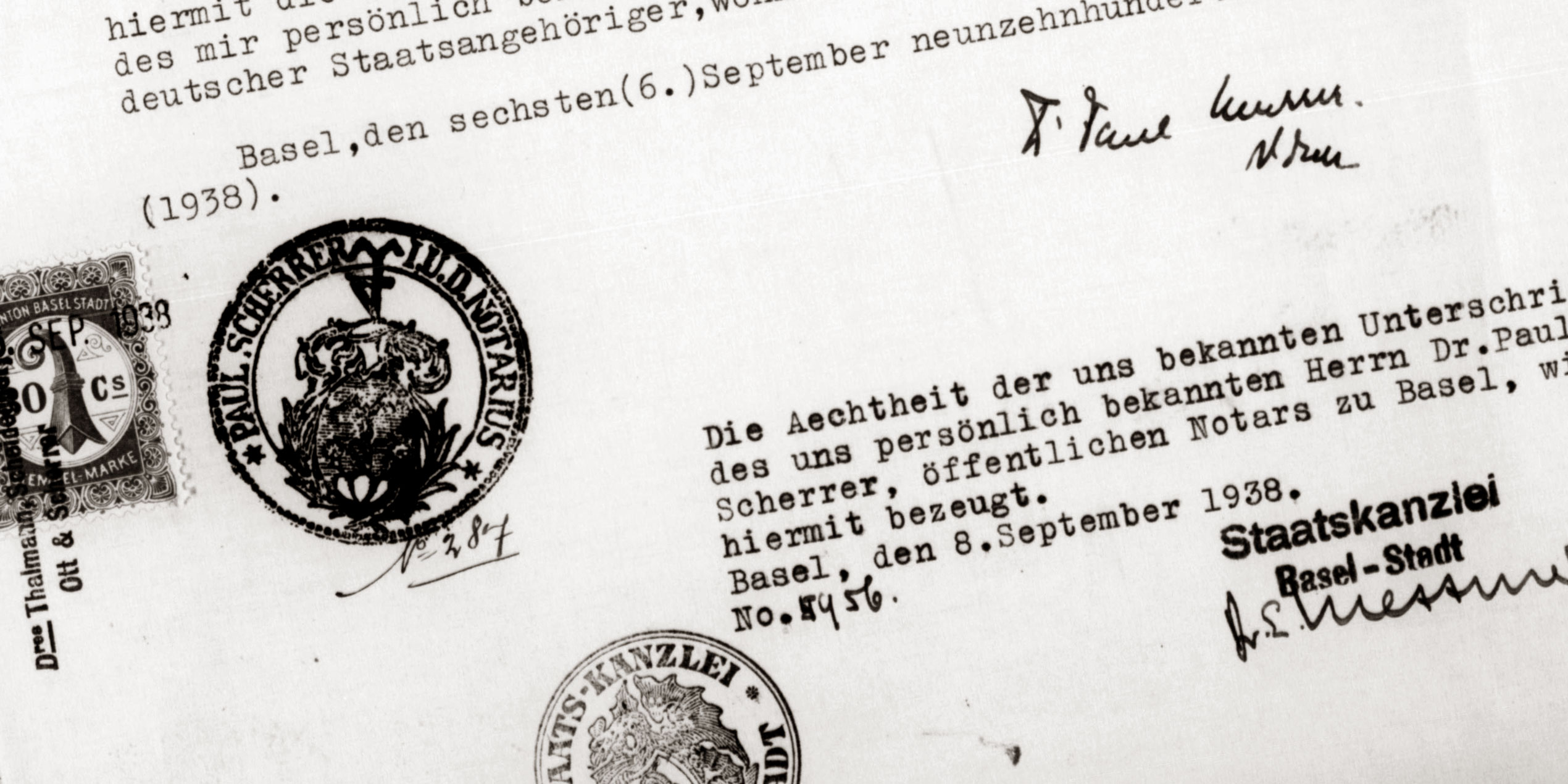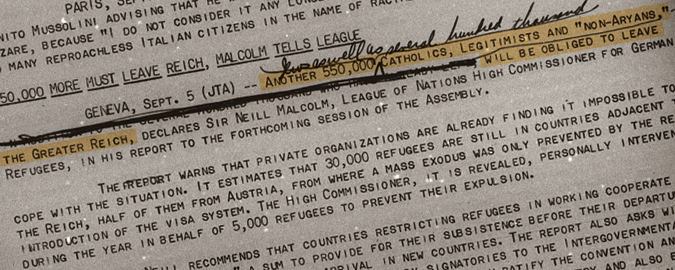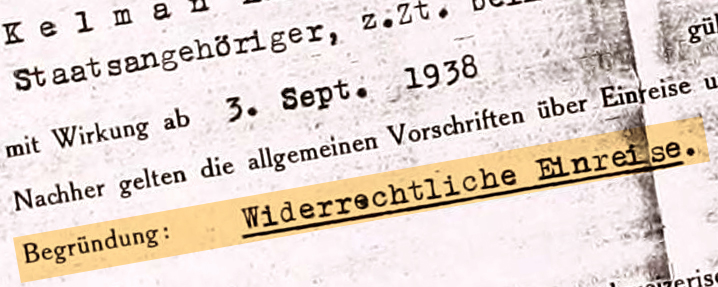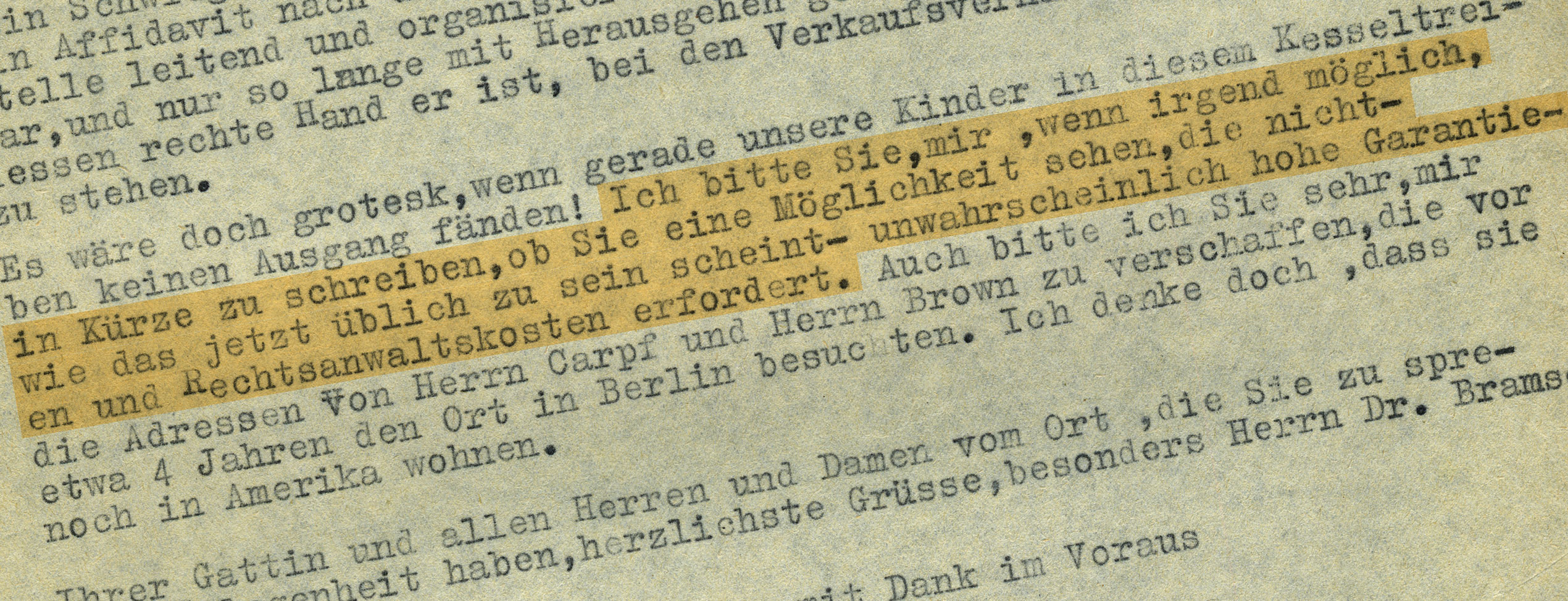China als Fluchtziel
Das Schiff SS Conte Verde bringt Juden nach China
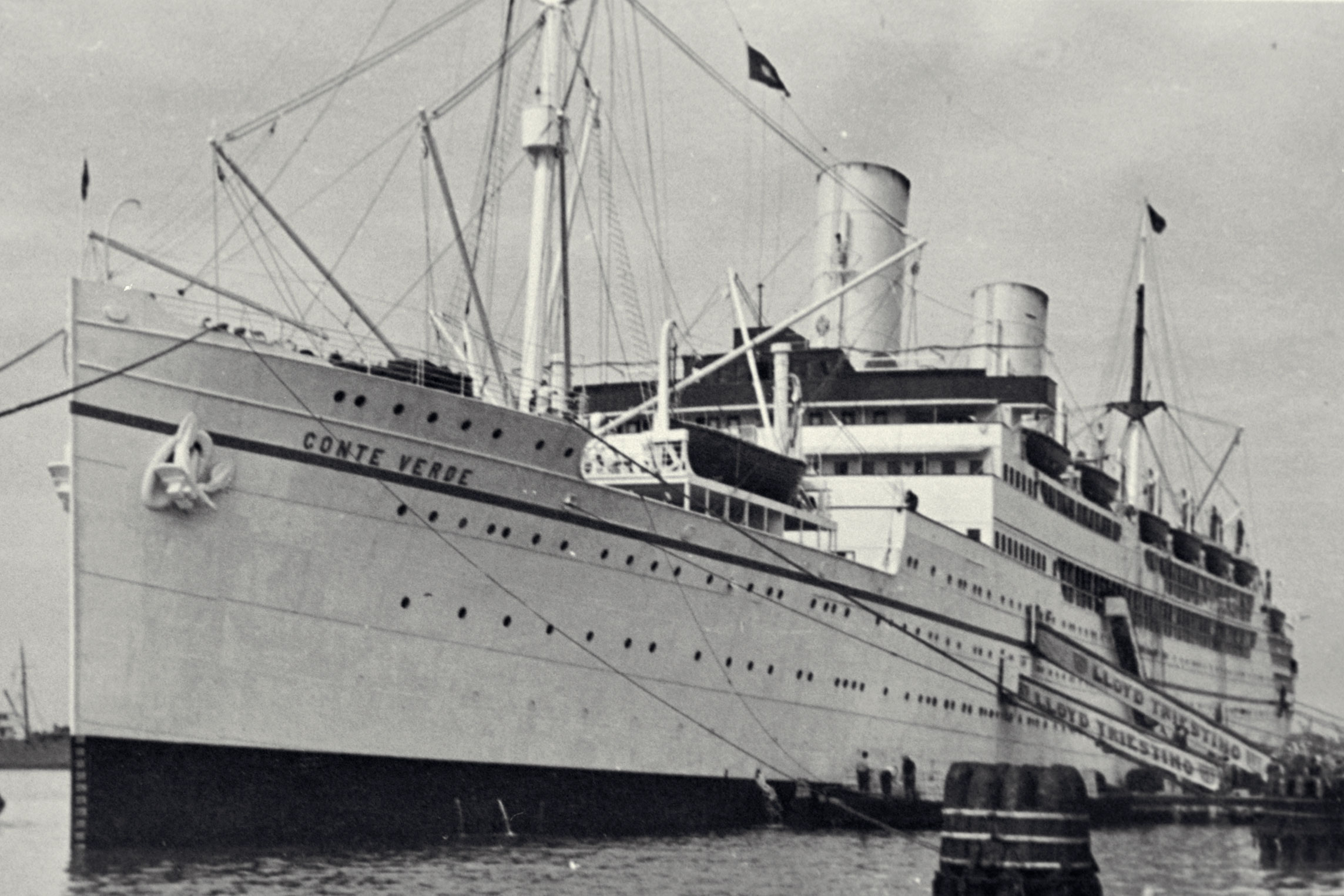
Triest/Schanghai
In den ersten Jahren des Nazi-Regimes hatten die Juden überwiegend in benachbarten europäischen Ländern, aber auch in Palästina und den Vereinigten Staaten Zuflucht gesucht. Als sich der Zugriff der Nazis ausweitete und Einwanderungsmöglichkeiten schwanden, wurde China zunehmend zu einem Zielort von Juden auf der Flucht. Die SS Conte Verde war eines der Dampfschiffe, die von den italienischen Häfen Genua und Triest aus Flüchtlinge nach Schanghai brachten. Die Seereise nach China dauerte einen Monat und war sehr kostspielig – eine Herausforderung für deutsche Juden, deren materielle Situation unter den Nazis erheblich erodiert worden war.
QUELLE
Institution:
Leo Baeck Institute – New York | Berlin 
Sammlung:
Original:
ME 999; F 55499
Source available in English